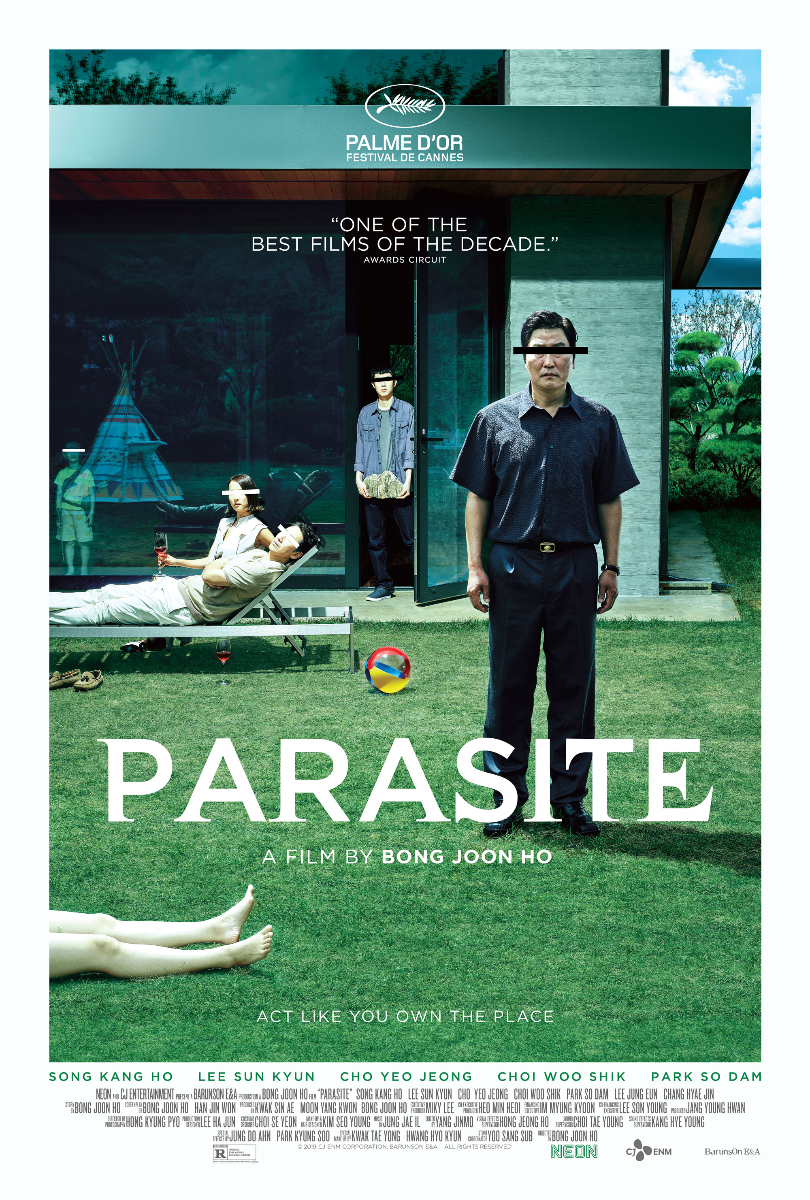Kritik: Star Wars – Der Aufstieg Skywalkers

Bildquelle: Lucasfilm
Mit dem vermeintlich finalen Akt der Skywalker Saga, Episode 9 an der Zahl, erklären Regisseur J. J. Abrams und die federführende Disney-Abteilung ihren künstlerischen Bankrott. Abrams gelingt das Kunststück, dem Kanon auch in seinem zweiten Star Wars-Film schlicht nichts hinzuzufügen. Fortwährend verwechselt Abrams Nostalgie mit authentischer Emotion und meint, das Erscheinen eines alten Geistes, das Abspulen eines bekannten Plotpoints oder neu vertonte alte Sätze könnten seine Sternensaga mit dem ausstatten, das ihr zwischen all dem drum herum gekleisterten Bombast und Hochglanz am dringlichsten fehlt: Der Wille, eine eigene Geschichte zu erzählen.
Beinah endlos mäandert Abrams auf ausgetretenen Pfaden, die er aufgrund der darin hinterlassenen, ohnehin viel zu großen Fußstapfen für gangbar hält, ja für die einzige Option, wie es scheint, ohne zu registrieren, dass ihm niemand mehr bereit ist zu folgen. Das Produkt Nostalgie funktioniert bei Disney-Remakes wie König der Löwen, aber es scheitert notwendigerweise, sobald ein Werk mit Substanz nicht nur reproduziert, sondern fortgeschrieben werden soll. In der Fortschreibung liegt freilich die Gefahr, Fehler zu begehen, wie es Abrams Vorgänger und Nachfolger Rian Johnson erfahren musste, der mit seinem The Last Jedi zwar Neues erzählen wollte, dabei aber die Gesetze des Universums aus den Angeln hob, die allein einen Film zum Krieg der Sterne machen. Abrams meidet diese Gefahr und entscheidet sich für ein Remake von Episode 6: Es gibt noch Gutes in ihm, dröhnt es durch die pseudodramatischen Momente dieses Konvoluts an ausgelassenen Chancen, doch am Ende bleibt nur die Bilanz, dass hier alles Gute, das der Originaltrilogie noch zu entreißen war, auf dem Altar des billigen Crowdpleasings geopfert wurde, was natürlich selbst wiederum genau jene beabsichtigte Befriedigung des Publikums unterminiert. Warum die finale Schlacht beispielsweise über Endor stattfindet und weshalb man während dieser schon weiß, dass Abrams am Ende einen Weg finden wird, Ewoks ins Bild zu mogeln, lässt sich nur so beantworten: Abrams wusste die meiste Zeit über nicht, was er sonst ins Bild holen sollte.
Dementsprechend blaß bleiben alle Figuren, die nicht unmittelbar mit der wiederaufbereiteten Frage der Bekehrung befasst sind. Dementsprechend unmotiviert rasseln die Lichtschwerter aneinander, sehen dabei höllisch gut aus und wissen nicht wofür. In all diesen Nichtigkeiten scheint der Mut Johnsons durch, der in Episode 8 Kylo Ren und seine Beziehung zu Rey tatsächlich mit so etwas wie Relevanz aufgeladen hat und damit post mortem Episode 9 als Einziger ein wenig Gewicht verleiht. Aber selbst dieses Potential verschenkt Abrams gnadenlos, ein bisschen Romeo und Julia, ein bisschen viel Return of the Jedi.
In kreativer Verzweiflung werden derweil allerlei neue Sidekicks eingeführt, die teilweise hilflose Versuche darstellen, den Hauptfiguren irgendwie Tiefe zu verschaffen, eine Ahnung von Vergangenheit hier, eine Möglichkeit zur Gefühlsäußerung dort. Andere erfüllen gar überhaupt keine Funktion im klassischen Plot-Sinn, sondern werden für die Dominanz der Bilder ausgeschlachtet. Wer Weltraum-Pferde durch sein Sternenepos reiten lassen will, braucht eben eine Pferde-Lady, um wenigstens den Anschein von Plausibilität zu wahren.
Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers reiht sich daher mühelos in das in Hollywood grassierende Nostalgie-Nudging ein, das nichts weiter beabsichtigt, als die Menschen mit Neuauflagen alter Geschichten scharenweise in die Kinos zu locken und dabei jeden Funken an künstlerischer Ambition negiert (IT, Ghostbusters, Disney-Remakes, Jurassic World etc.). Man will diesen Leute diese Geschichten entreißen, sie anklagen für die Verantwortungslosigkeit, die sie im Umgang mit ihnen an den Tag legen. Oder anders gesagt: Zwei Stunden Star Wars, schon wirst du ein Kommunist.